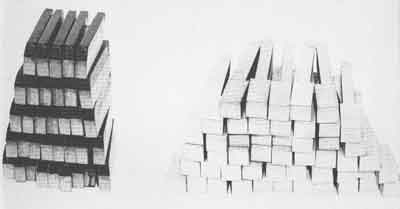Erschienen in Parallel Worlds, Programmheft Wien Modern '94
1994.
Eine längere Englischsprachiger Version erschien
in Key Notes XXVIII, 3, september
1994.
Guus Janssen und das Gefühl, sich auf dünnen Eis zu bewegen

Guus Janssen und ich leben im selben Dorf. Es heißt Nieuwmarktbuurt und liegt
inmitten der vielen anderen, die zusammen Amsterdam ausmachen. Auf dem Weg durch die
Buitenbantammerstraat zum Prins Hendrikkade denke ich an das erste Mal, als ich die
Musik von Guus hörte. Es muß im November 1980 gewesen sein, als das
niederländische Radiokammerorchester sein Toonen am Vredenburg Musikzentrum
in Utrecht aufführte. Oder war es noch früher? Toonen war einen Monat
davor in Donaueschingen aufgeführt worden, und ich erinnere mich dunkel an eine
Radioübertragung mit einem vor Indigniertheit summenden Publikum.
Die Musik von Guus Janssen war – und ist – unberechenbar. Wie unsere
Fahrräder: verbeult und ratternd, aber doch sparsamer und besser lenkbar als jedes
andere Transportmittel. Vielleicht sehen Nichtholländer ihre Vorzüge nicht
immer. Aber ich liebe Guus' Musik etwa so, wie ich mein Fahrrad liebe.
Ich habe ihn im BIM-Haus, auch in der Nähe, aber im nächsten Dorf, auf der
anderen Seite der Oude Schans, beim Improvisieren beobachtet. Wütende,
knochentrockene Martellatos, als würde er versuchen, seine Finger durch die Tasten
zu hämmern. Ich hörte ihn Cembalo spielen in De IJsbreker, Pogo III
nannte sich das Stück, wimmelnd vor Tönen, die wie ein Sack gelehriger
Flöhe umhersprangen. Ich lief ihm in die Arme im Amsterdamer Concertgebouw, als
Riccardo Chailly Keer dirigierte. "Was dieser Mann macht ... das ganze Stück
glänzt und strahlt", sagte Guus, "als hätte er es auf Hochglanz poliert". Sein
Gesicht strahlte auch.
Die Wohnung von Guus, obwohl nicht mehr so kahl wie noch vor zehn Jahren, ist sehr
nüchtern möbliert. Sobald ich sie betrete, fängt er an, mir von dem
Stück zu erzählen, an dem er gerade arbeitet: ein eiliger Auftrag für das
Schlußkonzert von Gidon Kremers Carte Blanche Serie im Concertgebouw. Es ist
für ein kleines Ensemble, in dem, neben der Geige, ein Hi-hat an prominenter Stelle
auftritt. "Es wird wahrscheinlich jenseits aller akzeptierten und sogar aller nicht
akzeptierten Normen sein", meint Guus. "Ich habe ein Hi-hat Thema genommen: es ist auch
auf meiner Solo-CD. Ich habe in diesem Stück das Hi-hat auf dem Klavier imitiert.
Auf der CD habe ich über dieses Thema improvisiert, aber ich könnte es genauso
gut durchkomponieren. Es soll eine Art von Abhandlung über Jazz werden: Swing, in
diesem Fall. Über eine swingende Geige, und eine swingende Geige klingt in meinen Ohren
sehr schnell falsch."
"Wenn ich im Zusammenhang mit Jazz an die Geige denke, fällt mir eine Figur aus
einem Pasolini-Film ein, ich weiß nicht mehr aus welchem. Ein Mann namens
Herdhitze, ein blaublütiger Typ, der irgendwo auf einem Gut in Deutschland lebt. Er
gibt unglaublich angsterweckende Theorien von sich. Spricht Deutsch mit italienischem
Akzent und das alles noch dazu am liebsten während er Harfe spielt. Ich kann
dieses Bild und diesen Namen nicht vergessen. Ich möchte dasselbe Gefühl in
diesem Stück heraufbeschwören. Kremer möchte ein leichtes, luftiges
Stück für sein Programm – er sprach von einer Hommage an Stephane
Grappelli, aber gleichzeitig hatte ich den Eindruck, er sei etwas geteilter Meinung
darüber. Ich werde ihm etwas Leichtes liefern, aber mit einem 'Herdhitzigen'
Unterton, was möglicherweise extrem makaber wird."
Inwiefern fällt es jenseits der akzeptierten Normen?
"Das Hi-hat: zunächst stochere ich damit herum, fast wörtlich.
Schließlich wird es anfangen, dasselbe Grundmuster zu spielen, wie es das im Jazz
immer tut, aber mit unendlichen Variationen und Überarbeitungen. Man könnte
sich fragen, ob dies nicht zu weit geht: das Hi-hat Grundmuster ist Jazz, ganz
eindeutig. Ein anderer Komponist würde es weglassen. Aber es ist eines jener
kleinen Dinge, die mich interessieren. Ich kann es nicht rechtfertigen, ich mache es
einfach. Und dann hoffe ich, daß es ein gutes Stück wird."
Ein Zustand des Staunens, in keinster Weise unvereinbar mit seinem Realitätssinn,
ist tief in Guus' Persönlichkeit verwurzelt. In seiner Musik sucht und modelliert
er die Logik des Erstaunens. Das ist oft verwirrend und manchmal geradezu umwerfend
komisch.
Preludium, die erste Improvisation auf seiner Cembalo-CD fängt an wie ein
Stück von Scarlatti, aber dann erfolgt ein abrupter Gangartwechsel und das
Stück gerät völlig aus den Fugen. Ehe man es sich versieht, landet es in
einem verzerrten Bluesmuster. Alles ist möglich, aber das Chaos hat stets seine
eigene Ordnung. Seine Improvisationen sind veritable Instantkompositionen, daher ist er
kein Jazzmusiker. Er setzt den Jazz immer zwischen Anführungszeichen.
"Ich suche nach Material, das sich zum Zerlegen eignet", sagt er. "Und das ist nicht
Wagner, zumindest nicht für mich. Es liegt nicht daran, daß mir etwa seine
Musik nicht gefällt, sie ist ungeheuer schön, aber auch heute noch
beschäftigt sich einfach jeder damit. Das Feld ist buchstäblich abgeerntet.
Ich spüre, wie mich die Erschöpfung packt, wenn ich nur versuche, da noch
etwas hinzuzufügen."
"Für mich ist Jazz eine Art von musikalischer Realität – eine der
vielen – und diese Realität kann man zum Ausgangspunkt für die
Erschaffung von etwas machen. Sie kann mit einer anderen Realität konfrontiert
werden, oder Elemente aus der einen können der anderen implantiert werden, und so
fort. Viele Komponisten verschließen sich bewußt diesen Realitäten. Sie
versuchen, einem einzigen Weg zu folgen, und das genügt. Ich versuche das ja auch,
aber es ist doch sehr angenehm, mich unterwegs auch einmal in der Gegend umzusehen."
"Ich weiß, daß es viele verschiedene Wege gibt, jeder hat seinen eigenen
Reiz. Man kann einen steilen Bergpfad wählen oder eine nette Strandpromenade.
Außerdem beeinflussen sich alle diese Wege auch noch gegenseitig. Diese Bandbreite
an Möglichkeiten fasziniert mich wirklich. Man darf nicht vergessen, auch im Leben
stößt man, wenn alles gut geht, auf die unterschiedlichsten Dinge. Einmal las
ich in einem Interview mit Edo de Waart, daß er Modelleisenbahnen besitzt. Das
finde ich interessant. Er dirigiert eine Mahlersymphonie oder eine ganze Wagneroper, und
dann geht er nach Hause und spielt mit einer Modelleisenbahn. Beim Komponieren sind
ähnliche Dinge möglich. Es ist nicht so leicht für den Performer, aber
ein Komponist kann sozusagen die zwei Welten integrieren. Natürlich ist die
Kernfrage, inwieweit die künstlerische Persönlichkeit dabei intakt bleibt."
"Ein weiteres gutes Beispiel ist Philip Guston, der amerikanische Malerfreund von
Morton Feldman. Jahrelang arbeitete er an monochromen Flächen und sehr abstrakten
Dingen. Aber wenn er von seinem Atelier nach Hause kam, setzte er sich an den
Küchentisch und zeichnete, zum Beispiel, einen Aschenbecher. Diese inkonsequente
Situation begann immer mehr an ihm zu nagen: es bereitete ihm genauso viel
Vergnügen, diesen Aschenbecher zu zeichnen, aber er wollte sein Atelier nicht
aufgeben. Dann sagte er sich: "Ich werde eben einfach diesen Aschenbecher malen". Das
war schon am Ende seiner Laufbahn. Ich finde das wunderbar, aber es wäre besser,
nicht ein ganzes Leben abzuwarten, bevor man sich sagt: 'Ich glaube, ich werde mir
einfach gestatten, in meiner Musik wieder Dreiklänge zu verwenden.'"
Es muß 1965 gewesen sein, als der Klavierlehrer von Guus, Piet Groot, ihm eine
Donemus LP von Peter Schats Concerto da camera vorspielte. Der
vierzehnjährige Guus wußte sofort: Das werde ich eines Tages machen.
"Das Komponieren nahm seinen Anfang im Schatten meiner Klavierstunden. Ich dachte
überhaupt nicht daran, ein Tschaikowsky oder etwas Ähnliches zu werden." Er
wählte bewußt Ton de Leeuw als Kompositionslehrer, obwohl er dem Interesse
nach eher Leuten wie Schat und Luis Andriessen nahestand: "Es ist sehr riskant, Stunden
bei jemandem zu nehmen, den man bereits nachahmt. Es ist nicht gut für die
Entwicklung."
"Sogar vor dieser Zeit war ich daran interessiert, mich mit der Psychologie des
Musizierens auseinanderzusetzen: was passiert, wenn man eine Passage verpatzt oder
nervös ist. Ton de Leeuw war dagegen. Er meinte es hätte zu anekdotischen
Charakter. Das ist ein klischeehafter Einwand, der mich seit langem ärgert, und ich
verstehe ihn immer noch nicht."
Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was sie damit meinen. In Toonen, beispielsweise,
kehrt das Hauptthema zurück, als wäre es mit 33 rpm auf einem Pick-up gespielt,
später dann mit 78 rpm, und am Ende klingt es, als sei die Nadel steckengeblieben.
Es ist eine Geschichte dahinter, und das bringt tatsächlich eine nicht-musikalische
Dimension ins Spiel.
"Stimmt schon", meint Guus. "Aber man kann sich nun natürlich fragen, ob das so
schlimm ist. Diese Art von Hörerlebnis gab es vor dem Pick-up nicht. Daher war es
unmöglich, sie vorher zu verwenden. In der Geschichte gab es immer wieder
Komponisten, die das, was sie hörten, für ihre Musik verwendeten. Das Klappern
von Pferdehufen beispielsweise, ist oft in Musikstücken aufgetaucht. Aber jetzt
hört man es in den Straßen nicht mehr, also wird es auch nicht mehr verwendet.
Es hängt alles davon ab, wie man mit diesen Dingen umgeht."
Es ist verlockend, Guus' Art zu sprechen mit seiner Musik zu vergleichen: einmal
zögernd, stockend, umwunden, dann wieder flüssig, voller Nebenbemerkungen und
unvollendeter Sätze. In seiner Musik sind diese Eigenschaften allerdings Absicht.
"In gewisser Weise liebe ich Verrücktheit. Aber gute Verrücktheit erfordert
Geschick, sie darf nicht zickig sein. In meinem Orchesterstück Keer wollte
ich eine Textur schaffen, die sich ständig auflöst, aber jede Auflösung
resultiert wiederum in einer Frage. Ich stellte mir Wellen vor, die an die Küste
donnern, übereinander schlagen. Die Frage war: welches Material würde diesem
Bild entsprechen? Und dann: welche Werkzeuge brauche ich, um das Material zu bearbeiten?
Eigentlich mußte ich ein ganzes Studio einrichten, bevor ich anfangen konnte."
Notenblätter liegen auf dem Tisch. Schemata mit Akkorden und Rhythmen. Guus
erklärt, daß er in früheren Kompositionen oft eine Art von "endlosem
Modulations-prinzip" durch den Quintenzirkel angewendet habe. Er begann mit ein paar
Tönen aus der C-Skala, die er sofort nach G modulierte, dann D, und so fort. Umso
schneller er durch den Quintenzirkel kreiste, umso weniger 'tonal' klang die Musik. Aber
durch ständige Änderungen in der Modulationsrate evozierte die Musik tonale
Assoziationen, ohne tatsächlich tonal zu sein.
Andere Komposition,en, nämlich Bruusk, basierten auf der Obertonreihe der
Baßklarinette. In dieser Reihe verbergen sich noch dazu zwei Dominantseptakkorde,
aus den ungeraden Obertönen gebildet. In Keer kombinierte er die zwei Prinzipien,
indem er das Endlosmodulationsprinzip auf den Bruusk Akkord anwandte.
"Mir gefällt die Idee sehr, dieses Grundprinzip der Zwölftontechnik (alle
Töne klingen zu lassen, bevor man weitergeht) mit etwas so Einfachem und
Natürlichem wie der Obertonreihe zu kombinieren", sagte er in einem Vortrag
über seine Musik."Es führt zu einem Trompe l'oeil einer Musik, die grenzenlos
und richtungslos ist, und doch gleichzeitig auf verrückte Weise (unrational und
maschinenhaft) nach Richtungen sucht. Gibt es in dieser Musik harmonische Progression
oder nicht? In Keer läuft auch die Tonhöhenmaschinerie ständig mit
anderer Geschwindigkeit. Wenn es so aussieht, als würde sie stoppen, hören wir
endlose Ketten von Dominantseptakkorden in Arpeggio. "
So sondiert Guus ständig die Grenze zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten.
"Streng serielle Musik kann ich nur auf eine Weise hören, indem ich Dinge darin
wiedererkenne: Ah, ... ich höre eine Quint, oder einen Dreiklang, sogar ein
Kinderlied. Offensichtlich sind wir so konditioniert. Das ist das Ergebnis einer
lebenslangen Musikausbildung. Vielleicht gibt es Leute, die das abschalten können.
Das wäre natürlich ideal, zumindest für diese Art von Musik. Dann
könnte man sie um ihrer selbst willen einschätzen. "
Und doch arbeiten Sie oft mit Reihen, entgegne ich.
Ist das der Einfluß des seriellen Konzepts?
"In gewisser Weise begann ich mit der seriellen Musik.
Mit vierzehn schrieb ich tatsächliche Zwölftonkompositionen, auf meine eigene,
primitive Art, natürlich. Und jetzt ... sicherlich setze ich Reihen nicht nur
für die Tonhöhen ein, auch oft für die Rhythmik, obwohl man es in der
Musik dann kaum hören kann. Es passiert oft, wenn ich versuche, ein Kontinuum zu
konstruieren, etwas, das sich bewegt aber nicht entwickelt. Wenn man sich der Sache
intuitiv nähert - meiner Ansicht nach der bessere Ansatz – dann kann es gut
gehen, aber es schleichen sich ganz verstohlen Dinge ein. Nach ein paar Takten kann es
schon zu schnell gehen, in Relation zum Anfang. Dann kommt es zu einer Entwicklung. Wenn
man Reihen geschickt einsetzt, kann man solche Probleme vermeiden."
"Das Hi-hat Muster, beispielsweise, könnte so geschrieben werden, daß es
zu schwanken beginnt. Diesen Effekt könnte ich erzielen, indem ich es über ein
Grundmuster laufen lasse, das selbst variiert." Guus nimmt ein Stück Papier und
beginnt zu schreiben: Quintole, Vierergruppe, Triole, Vierergruppe. "Das wird nicht
gespielt, das ist das Gerüst durch das das Hi-hat Muster durch muß. 3:2: 1,
eigentlich sehr einfach. Grundsätzlich eine Art von isorhythmischem Gedanken,
würde ich sagen."
"Sie haben es überhaupt nicht verstanden", sagt Guus. Er spricht über
Juist daarom, 1981 für Ensemble M geschrieben. "Tja, es ist tatsächlich
ein sehr merkwürdiges Stück, ein liebes aber eigenartiges Kind. Aber es ist
die erste einer ganzen Reihe von Kompositionen, Streepjes und Temet,
beispielsweise." Der Impuls für die Reihe war eine Begegnung mit Six Melodies,
einem Frühwerk von John Cage für Geige und Klavier aus dem Jahr 1950. "Ich habe
es selbst gespielt, mit Jan Erik van Regteren Altena, und es hat den Komponisten in mir
niemals wieder losgelassen. Es ist so abgewogen und geschäftsmäßig, mit
einer hauchdünnen Lyrik, ein Gefühl, wie es ein Schlittschuhläufer auf
dünnem Eis hat."
Genügend Grund für Guus, Cages Stück in einem 'Komponistenportrait' im
heurigen Holland Festival neben seiner Oper Noach einzuplanen. Außer seiner
eigenen Musik wird dort auch ein Trio von Wolfgang Rihm aufgeführt. "Nur ein
einziger Satz, die anderen treffen meinen Geschmack nicht so, man könnte sagen, es
sei erweiterter Schumann. Aber der erste Satz ist sehr konzentriert und sehr scharf. Es
geht auch um sehr primitive musikalische Prämissen: Quinten, Primen, alle diese
Grundkonzepte, die man am Anfang von Musiklehrbüchern findet. Es gefällt mir
wirklich, und dieser Rihm ist ein erstklassiger Komponist; besonders seine visionäre
Breite, etwas das mir vielleicht fehlt."
Ich verstehe nicht ganz, was Sie mit visionärer Breite meinen.
Er lacht. "Wie soll ich es ausdrücken? ... Was ich mache ist eine Art von
schürfen oder graben. Und graben ist nun mal graben, obwohl auch das sehr
tiefschürfend und interessant sein kann. Aber bei Rihm ist es mehr so wie in den
Bildern Caspar David Friedrichs, und innerhalb dieses Panoramas fallen die kleinen
Menschen fast gar nicht mehr auf."
"Auch das ist es nicht, was ich tun will. Na ja, manchmal probiere ich es ein
bißchen. In Noach, zum Beispiel, gibt es eine Passage, in der das Paradies
auf der Insel Mauritius beschrieben wird, als der Dodo dort noch ungestört lebte.
Eine der bewegungslosen Passagen. Das ist mein Anliegen bei der visionären Breite.
Es ist leichter bei Opern. Da kommt sie von selbst, wenn auch nur weil dort die Zeit
strukturiert ist. Wenn ich mich durch die ganzen zwei Stunden des Stückes einfach
nur durchgraben würde, das wäre, glaube ich, entsetzlich ermüdend
für das Publikum.
Guus Janssen, der Notengräber, Meister der feingezogenen Linie, beendete letztes
Jahr ein abendfüllendes Gemälde: Noach. Natürlich ist dies keine
Allerweltsoper, Guus ist schließlich Guus. Und auch der Librettist Friso Haverkamp
ist kein Allerweltsschriftsteller.
Noach ist eine auf den Kopf gestellte und zynisch verpackte Version der
Geschichte aus dem Alten Testament. Die Taube wird zum Skelettvogel, der Regenbogen zu
einem Starkstromlichtbogen. Noah ist ein selbsternannter Gott, der seine Freude an der
Vernichtung der Tierwelt hat. Es kommt zum großen Konflikt mit seiner Frau, die
sich auf die Seite der Tiere stellt. Sie sitzt auf dem Rücken eines Buckelwales
– einer 'Gegenarche' – und weigert sich, an Bord der Arche zu gehen.
Die Oper Noach ist für eine größere Formation von Guus'
eigenem Ensemble geschrieben, das in dieser Produktion unter dem Namen New Artis
Orchestra auftrat mit Genehmigung von Artis, dem Amsterdamer Zoo. Guus beschreibt das
Endprodukt, eine Partitur von 400 Seiten, als "so löchrig wie ein Schweizer
Käse". Neben den durchkomponierten Teilen finden sich nämlich Stellen für
Improvisationen, die nach verschiedenen Regeln ablaufen. Zusätzlich gibt es eine
enorme Menge an Tonbandgeräuschen (meist Tierlaute), Ringmodulatoren, etc.
Guus: "Auf einer Ebene handelt die Geschichte vom Raubbau des Menschen an der Natur.
In den zwei Jahren, die ich an der Oper arbeitete, tauchten diese Dinge immer wieder auf.
In der Morgenzeitung las ich beispielsweise einen Artikel über einen Kapitän,
der Öl in den Ozean pumpen ließ, mit Bildern von Seevögeln, die ans Ufer
geschwemmt wurden. Man kann sich gut vorstellen, wie er da so auf seiner Brücke
stand: er wurde einfach zu Noah. Es motiviert einen, mit dem Komponieren weiterzumachen."
Das nächste Mal sah ich Guus am 1. März. Gidon Kremer hat sein Konzert im
Concertgebouw gerade beendet, und ein kleines Grüppchen versammelt sich vor seiner
Garderobe. Unter ihnen sehe ich Guus mit einer Partitur unter dem Arm. Es wurde ihm eine
Audienz gewährt, Guus winkt fröhlich.
Auf dem Deckblatt der Partitur prangt der Titel Klotz.
"Ich habe nachgeschlagen", sagt er, "Es kommt von Porcile. Und der Mann, der die
Harfe spielt heißt Klotz, nicht Herdhitze." Wir blättern durch die Seiten.
"Sehen Sie sich das an", meint Guus überschwenglich, und deutet auf eine Stelle.
"Damit bin ich besonders zufrieden."